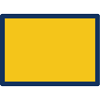13.07.2025
Verhältnisse vom 24.02.2021
Piz Segnas (3098m): Von der Bergstation Cassons
Letzte Änderung: 24.02.2021, 19:07Aufrufe: 2422 mal angezeigt
Aktuelle Verhältnisse in der Umgebung
Piz Segnas (3098m)
Von der Bergstation Cassons
Hintergrundkarten
Info-Ebenen
Risikokarten virtueller Lawinenbulletins
© 2018 Skitourenguru.ch
Welches Lawinenbulletin gilt in deiner Region?
Karte